MOSFET-Sache: Das Gate hängt jetzt auf ~-15V. Das sollte ja passen, oder?
OP: Oh ja stimmt, der war falsch herum.. Habs jetzt geändert und die Widerstände R3 und R1 aufgeteilt und einen Kondensator dazwischen. Passt die Schaltung jetzt so? Wie müsste man denn die Bauteile dimensionieren, also vor allem C4 und C6? Und sollte man noch ein RC-Glied zusätzlich ganz hinten an den Ausgang?




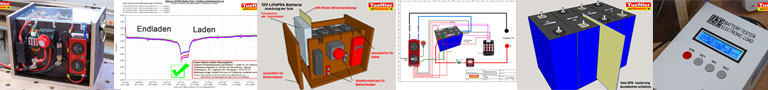



 Zitieren
Zitieren
Lesezeichen