Bei einer Nachführung mit Schrittmotoren wird man um eine geeignete Getriebestufe nicht herum kommen, denn sonst wird es zu ungenau werden (in der regal machen Schrittmotoren 1° bis 2° pro Schritt?).
Abgesehen davon würde das Drehmoment bzw. Haltemoment deutlich besser werden, es bietet sich wohl ein Schneckengetriebe an. Außer sowas ist an deinem Dobson schon verbaut.




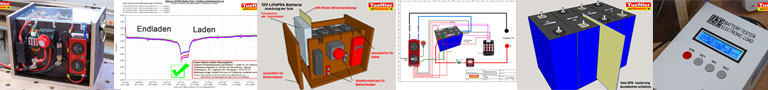



 Zitieren
Zitieren



Lesezeichen