@ranke Sehr gute Erklärung. Dadurch wird auch klar, warum die Anzahl der Stator- und Rotorpole ungleich sein muss.
Ich möchte aber etwas weiter philosophieren.
Wir bleiben bei den 24 Statorpolen und den 26 Rotorpolen von Tom.
Wenn man jetzt zusätzlich zu den "aktivem" Wicklungen 3 oder 6 zusätzliche "Hilfswicklungen" aus dünnerem Draht einbringt, die nur für das Halten quasi als Bremse zuständig sind, dann kommen wir doch dem idealen Servomotor ein ganzes Stück näher. Diese Wicklungen könnte man ja auch zur Istwerterfassung der Drehzahl nutzen.







 Zitieren
Zitieren

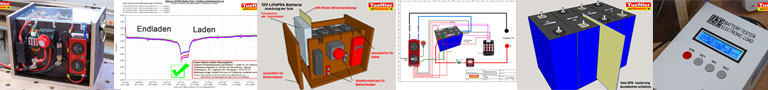
Lesezeichen