Hallo Andreas,
Wie ich sehe, hast Du Dir einige Gedanken über die Ressourcenaufteilung der Rechenleistung des Mikrocontrollers gemacht, und diese sogar berechnet. Ja, da bei der Wechselrichtersteuerung sowohl bei der PWM-Ausgabe, als auch im Regelalgorithmus ausschließlich triviale Berechnungen benötigt werden, reicht die Rechenleistung eines AVR-Controllers der MEGA-Serie im grunde leicht aus.
Das Codebeispiel eines PID-Reglers, beschrieben hier im Forum, finde ich auch sehr gut, und hat mir bei der Verwirklichung meines balancierenden Roboters sehr geholfen. Da die Regelung der Zwischenkreisspannung jedoch nicht übertrieben schnell sein muss, habe ich mich bei meinem Wandler für eine einfache Implementierung eines PI-Reglers entschieden, dessen Parametrisierung sich deutlich einfacher gestaltet. Die einfachste Methode, Deinen PID-Regler zu konfigurieren ist, wie Du schon sagtest, der empirischer Weg. Wobei es auch hierfür Wege und Methoden gibt, um die passenden Parameter mit vertretbarem Aufwand zu finden. Ein bekanntes Verfahren hierfür ist jenes von Ziegler und Nichols.
Ich habe die Software für meinen Wechselrichter ebenfalls in C geschrieben, ist ja auch der Industriestandart. Eine Bemerkung über Bascom verhalte ich mir an dieser Stelle, welches Du ja zum Glück nicht benutzt.
Bei der Ausführung der Speicherdrossel ist es wirklich am einfachsten, einen passend großen ETD-Kern mit geeignetem Luftspalt zu verwenden. Dadurch ist sichergestellt, dass das magnetisch leitende Material für die verwendete Frequenz geeignet ist. Außerdem gestaltet sich das Wickeln des Spulenkörpers deutlich einfacher als bei Ringkernen.
Klar, mit dem Mikrocontroller kann man sich diverse Parameter berechnen. Nur, um qualitative Aussagen über den aktuellen Wirkungsgrad machen zu können, reicht es nicht aus, nur die Zwischenkreisspannung zu messen, da hier weder die Verluste der Ausgangsvollbrücke, noch die des Ausgangsfilters berücksichtigt werden. Hierfür müsste man die Ausgangsspannung – zumindest eine Phase – gegen Masse messen, und den Spitzenwert berechnen. Nach Berücksichtigung des Formfaktors – nicht deformiertes Sinussignal vorausgesetzt – kann man so in Kombination mit dem Brückenstrom auf die einigermaßen richtige Ausgangswirkleistung schließen. Nicht berücksichtig, da so nicht messbar, werden jedoch Blindströme komplexer Verbraucher.
Wofür willst Du den Wechselrichter schlussendlich eigentlich verwenden? Bei meinem Projekt ging es damals eigentlich nur darum, ein derartiges Projekt zu realisieren, also nur um den Weg dahin.
Beste Grüße,
Roland.








 Zitieren
Zitieren

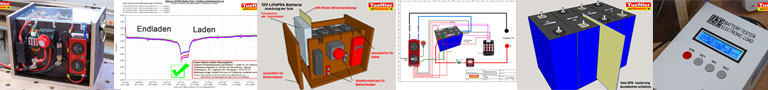
Lesezeichen