-

-
Umwelt-Sensor
Hallo zusammen ich bau zwar keinen Roboter, aber ich habe ein Problem mit Sensoren und so wie es scheint gibt es hier einige Experten und daher versuch ich es mal 
Hallo
Ich studiere momentan Internationales Wirtschaftsingenieurwesen im 4. Semester. Zur Abwechslung nehme ich dieses Jahr an einem Projekt teil in welchem eine Produktidee technisch und wirtschaftlich (auf dem Papier) zur Marktreife entwickelt werden soll. Das Themengebiet wurde in sofern eingegrenzt, dass es sich um eine Wireless Sensor Network handeln soll. Meine Gruppe hat sich überlegt die Lawinenvorhersage zu verbessern und dazu in gefährdeten Gebieten Sensorstäbe zu installieren welche im Winter vom Schnee bedeckt sind und so aktuellen Daten über die Schneedecke per Funk ins Tal zu einem zentralen Auswertungsterminal schicken.
Natürlich braucht man hierzu die richtigen Sensoren und da kommt ihr als Experten auf diesem Gebiet ins Spiel. Ich bin euch für jede Antwort auf meine Fragen dankbar uns bitte verzeiht mir wenn ich die ein oder andere dumme Frage stellen sollte aber wie gesagt ich bin absoluter Laie. Wie gesagt sollten die Sensoren Informationen über die Schneedecke liefern. Hierzu müssten sie als die Dichte, Temperatur, Wassergehalt und Luftgehalten des Schnees messen können. Des Weiteren wäre ein Regensensor, Windsensor und ein Art Sonnensensor (welcher die Intensität der Sonneneinstrahlung erfasst) am oberen Ende des Stabes sicherlich sinnvoll Natürlich müssen die Sensoren den Witterungsverhältnissen in den Alpen gewachsen sein. Gut jetzt stellen sich die Fragen
- welche Sensoren
- welche Ausmessung haben sie
- wie sieht der Energieverbrauch aus
- wie viel kosten die Sensoren
- in welcher Format die Messdaten ausgegeben werden und welche Geräte ich benötige um die Messwerte für einen PC verständlich zu machen
Für Infos in diese Richtung oder eine Quelle in der ich diese Infos finde wäre ich sehr sehr dankbar. Schon mal danke fürs Lesen und im Voraus vielen Dank für Antworten jeder Art
Grüße
Markus
-
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Hallo Markus,
wesentliche Grundanforderungen an die Sensorik dürfte sparsamer Energieverbrauch sein (autark für 6 Monate) und die Witterungsbeständigkeit.
Für die Schneehöhe wäre denkbar:
Ultraschall Entfernungsmessung von einem Ausleger an der Sondenspitze senkrecht nach unten. Alternativ auch optische Triangulation.
Für Windmessungen sieht man häufig Halbschalenanemometer.
Temperatur der Luft und im Schnee: hier gibt es viele preiswerte und robuste Sensoren, z.B. NTC.
Sonnenstrahlung: z.B. Fototransistor, Fotowiderstand, Fotodiode.
Dichte des Schnees: Das scheint eher schwierig zu sein. Ein unmittelbares Abwägen eines Schneevolumens ist schlecht möglich. Die Absorption von energiereicher Strahlung ist häufig proportional zur Masse zwischen Strahlungssender und -Empfänger. Vielleicht findet man ja eine Abhängigkeit der Intensität von kosmischer Höhenstrahlung? Zusammen mit der Schneehöhe, könnte man auf die Dichte schliessen.
Zu einer entsprechenden Sensorik kann ich nichts sagen, habe ich selbst keine Erfahrung.
Vielleicht geht als Näherung auch die Abschwächung optischer Strahlung (obwohl auch viel Staub im Wind verfrachtet wird)
Wassergehalt: Möglicherweise über die Dielektrizitätskonstante. Diese ist für Luft etwa 1, für gefrorenes Wassr etwa 3, für flüssiges Wasser etwa 81.
Der Energieverbrauch der Sensorik kann man niedrig halten, da sich die meisten Messwerte nur langsam ändern. Man macht dann nur eine Messung pro Stunde. Nur Wind, Strahlung und Lufttemperatur will man eventuell öfter messen.
Ein wesentliches Problem könnten die Witterungseinflüsse bilden.
Auf dem Bild sieht man, wie sich Schnee anlagern kann.
http://www.planai.at/images/content/Gipfelkreuz.jpg
-
 Berechtigungen
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln







 Zitieren
Zitieren
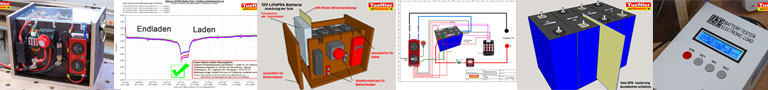
Lesezeichen