hallo jmetzkow,
hab gerade mal wieder ins forum geguckt und bin total erfreut, dass der thread noch gelesen wird und bezügl. der Induktionsschleife noch Beiträge kommen! Die Induktionsschleife ist meiner Meinung nach für Rasenrobos das geeignesten, um auch kompliziert geformte Begrenzungen sicher und einfach festzulegen. Mein Robo ist zumindest noch nicht im Teich gelandet.
Für den Operationsversärker denke ich, kannst Du jeden beliebigen nehmen. Ich habe zwar nur 2 ausprobiert, da aber keine besondere Ansprüche bestehen, müsste eigentlich jeder funktionieren.
Die Lösung von csack für den Sensor finde ich auch interessant. Ich habe mich zu Beginn für eine Verstärkung unmittelbar nach der Spule entschieden, da ich sicher gehen wollte, dass von dem Sensor bis zum Mikrokontroller auch ohne Abschirmung und über längere Leitungen keine Störungen auftreten. Ob eine Ferritantenne oder eine Relaisspule effizienter ist, kann ich nicht beurteilen, da nicht selber ausprobiert. Eine Spule aus einem Relais ist halt klein, braucht nur 1 cm lang zu sein. Eine Ferritantenne mit 8 cm Länge ist vielleicht nicht immer gut zu verbauen. Wichtig ist sicher eine hohe Windungszahl.
Gut in csack´s Lösung ist sicherlich, dass man auf ein Programm mit Schleife, so wie ich es geschrieben habe, verzichten kann. Hab dies aber noch nicht ausprobiert, da meine Sensoren bis jetzt problemlos und sicher funktionieren. Never touch a running system !
Die Induktionsgeneratoren von csack und mir sind ja fast identisch. Wichtig ist ja nur einen Rechteckimpuls zu generieren, der für kurze Zeit den mosfet durchschaltet, z.B. mit der 1% Impulsbreite von csack. Mit der Frequenz kann man spielen. Mir reichen z.B. etwa 10 Hz. Wie die Ansteuerung erfolgt, ist ja letztlich beliebig. Ein NE555 würde auch ausreichen. Bei meiner Schaltung habe ich allerdings festgestellt, dass sie temperaturabhängig ist. Da ich den Generator in einem schwarzen Gehäuse verbaut habe, ist im Sommer die Frequenz deutlich nach oben gegangen. Die Frequenz hat dann nicht immer optimal zu dem Programmablauf auf der Empfängerseite gepasst. Ich mache deshalb inzwischen die Ansteuerung mit einem ATTiny2313 mit entsprechenden Miniprogramm in dem ich Impulsdauer und Frequenz genau vorgeben kann. Meine und csacks Lösungen kann man sicher kombinieren. Z.B. die Sache mit den 2 antiparallelen Dioden + Relaisspule + OP. Wieso das mit den antiparallelen Dioden funktioniert, verstehe ich allerdings noch nicht. Bewirken diese nicht einfach einen Kurzschluss?
Ein Tip zum Erbroben des Induktionsgenerators:
Zum Testen ob die Schleife funktioniert, kann man einfach die Spule direkt an einen simplen Kopfhörer (wie für mp3-Player) etc. hängen und hört - wenn er funktioniert - ein Knacken, entsprechend der gewählten Frequenz. Ist man soweit, kann man den Sensor weiter ausbauen.
Viel Erfolg! Würde mich freuen, wenn Du uns mitteilst, dass die Induktionssache erfolgreich nachgebaut werden kann!
Christian








 Zitieren
Zitieren



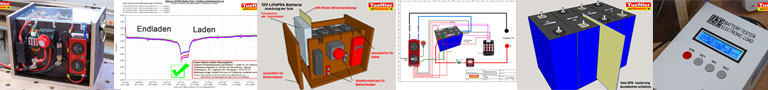
Lesezeichen