@ root
Wenn man nicht den Ferritkern in einer Luftspule verschiebt, sondern den Luftspalt in einem (sonst geschlossenen) Ferritkern ändert, dann reagiert der Schwinkreis schon auf wenige Prozent Änderung des Luftspalts. Bei entsprechend kleinem Luftspalt kann man also sehr kleine Bewegungen messen. Damit kann die Feder sehr steif werden. Ist allerdings nichtlinear und man bekommt auch so Dinge wie Wärmedehnungen mit in die Messung.Im Moment helfe ich mir so, daß in der Schubmechanik eine
Zug/Fruckfeder durch die Zug/Druckkräfte verformt wird
und einen Ferritkern in einer Spule Verschiebt. Diese Spule ist
Teil eines HF-Oszillators. Das wird dann runtergeteilt und
gibt als Frequenz so halbwegs die auftretenden Kräfte wieder.
@ steve:
erschwinglich ist relativ...nur wo gibts es sowas (erschwinglich)
Google mal nach "Kraftmessdose" oder "Wägezelle". Eher teuer. Alternative ist Selbstbau, wie ihn Thoralf in https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...781&highlight= beschreibt. Ich habe nur von anderen Leuten gehört, daß die Kleberei nicht so ganz trivial sein soll.
Man benützt meistens mehrere (2 oder 4) DMS pro Meßstelle. Gründe sind z.B. daß die temperaturabhängigkeit des einen DMS durch den anderen DMS kompensiert wird. Man kann durch geeignete Anordnung auch unerwünschte Kraftkomponenten aus der Messung herausnehmen.wozu sind da 2 dms (links und rechts) drauf?
Beispiel von NRicola's G:
Wenn die Kraft F wie in der Zeichnung wirkt, dann wird der linke DMS verlängert (Widerstandserhöhung), der rechte gestaucht(Widerstandsverminderung). Durch eine geeignete Brückenschaltung verdoppelt sich damit der Effekt der Widerstandsänderung. Wird dagegen am oberen Ende eine Richtung des Pfeils "L" aufgegeben, dann werden beide DMS entweder verlängert oder gestaucht. Durch die Brückenschaltung wird das kompensiert. Bei nur einem DMS hätte man ein Signal bekommen für etwas, was man gar nicht messen wollte.








 Zitieren
Zitieren
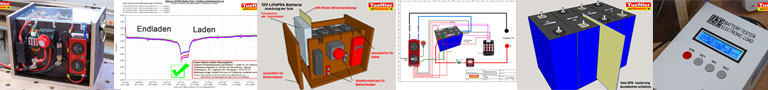
Lesezeichen